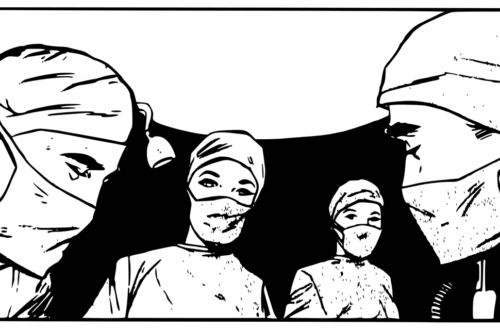“Der Patient ist überlagert” – wie Sprache unser Bewusstsein bestimmt
Eines Tages kam eine psychologische Kollegin mit einer Konsilanforderung in der Hand zu mir und fragte: “Die schreiben hier, der Patient sei überlagert. Was bedeutet das?”
Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mir über den Begriff keine tieferen Gedanken gemacht. Natürlich kannte ich ihn seit vielen Jahren und ich vermute, dass er mir schon im Studium begegnet ist. In der Medizin wird er recht freizügig überall dort verwendet, wo psychisch aberrantes Verhalten beschrieben werden soll (wobei schon völlig unklar ist, was eine psychische Aberration sein soll).
“Der Patient ist überlagert” – gerne auch in seiner Steigerungsform “Der Patient ist total überlagert” oder in der Variante “Gut dass Sie da sind! Der ist echt überlagert.” – bedeutet in meiner gefühlten Übersetzung in etwa so viel wie: “Der Mensch ist total bekloppt.”
Überlagert impliziert auch, dass die wahre, wichtige und relevante Erkrankung (die Körperkrankheit) von einer diffusen Befindlichkeitsstörung, die maximal eine Krankheit zweiter Klasse ist (wenn überhaupt) überdeckt wird.
Ein veraltetes Bild von Krankheit
Hinter dem Begriff steckt die überkommene Vorstellung eines Leib-Seele-Dualismus, in welchem Krankheit immer entweder körperlich oder psychisch bedingt ist.
Die moderne Medizin kennt aber schon seit Jahrzehnten das biopsychosoziale Konzept von Krankheit, das – vereinfacht ausgedrückt – nichts anderes sagt, als das JEDES Krankheitsbild körperliche, psychische und soziale Aspekte hat, die zur Entstehung, zur Symptomausprägung und nicht zuletzt zur Heilung der Krankheit beitragen.
Ja, auch der Herzinfarkt, denn neben Zigarettenrauch und metabolischem Syndrom sind Angsterkrankungen und Depression relevante Ursachen für Herzkreislauferkrankungen.
Ja, auch der Diabetes mellitus, den überdurchschnittlich viele in ihrer Kindheit traumatisierte Menschen bekommen.
Ja, auch die Krebserkrankung, deren kraftzehrende Therapie von Menschen mit einem tiefen Gottesglauben offenbar besser überstanden wird.
Und sogar die banale Viruserkältung, die einen schnelleren Anstieg der Leukozyten und signifikant weniger Schnupfentage aufweist, wenn die Beziehung zwischen Patient*in und Behandler*in vertrauensvoll ist.
“Das ist doch nur eingebildet”
Im Begriff der Überlagerung steckt darüber hinaus die (etwa aus dem Jahr 1900 stammende) Vorstellung, es gäbe eine Hierarchie von Krankheiten, nämlich “echten” (=körperlichen) und “eingebildeten” (=psychischen). Und dass psychische Erkrankungen mit Simulation, Willensschwäche oder Versagen gleichzusetzen sind. Diese Idee ist von den Neurowissenschaften und der klinischen Forschung im Bereich Psychiatrie und Psychosomatik lange widerlegt.
Dennoch hält sich hartnäckig die Vorstellung, psychisch Kranke seien “irgendwie selbst schuld”, sie könnten ja auch einfach aufhören mit dem depressiv sein.

Auch die leider immer noch weit verbreitete Idee, psychische Erkrankungen seien weniger “gefährlich” als körperliche, hält einer Wirklichkeitsprüfung nicht stand.
Die Anorexia nervosa (als eine klassischerweise der Psychosomatik zugeordnete Erkrankung) ist eine der Haupttodesursachen von jungen Frauen. Im Jahr 2019 starben in Deutschland 9014 Menschen durch Suizid. Das sind 25 Suizident*innen jeden Tag.
Psychische Erkrankungen sind mit einem relativen Anteil von einem Drittel seit einigen Jahren die Hauptursache für Berufsunfähigkeit und haben damit Krebs-und Atemwegserkrankungen von der Spitze dieses traurigen Rankings verdrängt.
Explizit auf die Vorstellung von “minderwertigen” psychischen Erkrankungen angesprochen würden die meisten Ärzt*innen (möglicherweise auch wegen einer sozialen Kontrollfunktion) widersprechen. Aber im alten Begriff der Überlagerung lebt eine nicht zulässige Simplifizierung und Verachtung fort, sei es als gedankenloser Ausdruck von Genervtheit, sei es als wohlgehütetes (oder kaum bewusstes) Ressentiment.
“Der kann gar keine Schmerzen haben”
Zugleich offenbart der Begriff “überlagert” einen frappierenden Mangel an Empathie, denn er blendet die Tatsache aus, dass Patient*innen individuell (und nicht routiniert) auf Krankheitszustände reagieren und mit Krankheit umgehen (dieser wissenschaftlich recht gut beschriebene Prozess nennt sich Krankheitsverarbeitung).
Vor allem das Symptom Schmerz ist hoch subjektiven Verarbeitungs- und Entstehungsprozessen unterworfen, die über ein eindimensionales Verständnis von Nozizeptoren und Neurotransmittern hinausgehen. Dennoch hört man im Krankenhaus oft genug den Satz “Der Patient kann keine Schmerzen haben. Der hat ja schon Morphium bekommen.”
Diese gedanken- und phantasielose Übergriffigkeit, sich anzumaßen wissen und bestimmen zu wollen, was ein anderer Mensch fühlt, wird von den Betroffenen als exakt so aggressiv erlebt, wie es gemeint ist: es invalidiert das Erleben von Patient*innen, führt zu Enttäuschung, Wut, psychischem Schmerz, was sich schlimmstenfalls in einer Verschlechterung des Gesamtschmerzerlebens äußert.
Wenn dann ein schmerzgeplagter Mensch trotz der als ausreichend erachteten Gabe eines Schmerzmittels weiter über Schmerzen klagt – oder noch schlimmer: sich über die ihm zugedachte (unzureichende) Behandlung beschwert – ist es oft einfacher, die gedankliche “Der ist überlagert” Schublade aufzumachen, als sich mit dem individuellen Phänomen auseinanderzusetzen.
Ein weiteres abwertendes Wort in Bezug auf die individuelle (und in diesem Fall kulturgeprägte) Krankheitsverarbeitung ist die Spottbezeichnung “Morbus mediterraneus”, die benutzt wird für Menschen, die gebürtig aus einem Mittelmeeranreinerstaat stammen und die körperliche Beschwerden (vor allem Schmerzen) sehr expressiv darstellen. Auch hier findet eine (zutiefst rassistische) Vereinfachung statt, die ganze Bevölkerungsgruppen über einen Kamm schert und zugleich das Leid der Betroffenen ausblendet.
Wo ist jetzt das Problem?
“Na und?” könnte jetzt als Gegenargument kommen (vorzugsweise aus der gleichen Ecke, die gerne von “Genderwahn” fabuliert und es auch nicht so dramatisch findet, das N-Wort zu benutzen). “Es ist doch nur ein Wort. Nur ein Witz. Nicht böse gemeint.”
Aber das ist es eben gerade nicht.
Denn erstens ist die Sprache, die wir nutzen ein ziemlich guter Indikator für die Gedanken, die wir denken, und die Gefühle, die wir fühlen. Es gehört zu den Kernkompetenzen meines Berufsstands, diese Schnipsel aus den Tiefen des Unbewussten an die Oberfläche zu bringen und zu einem stimmigen Bild zu komponieren. Das Unterbewusste lügt nicht. Schon mal was von Freudschen Fehlleistungen gehört? Eben.
Zweitens funktioniert das wie beim Embodiment auch andersherum: das, was ich sage, prägt die Art und Weise, wie ich denke und fühle. Als Mitglieder eines Teams, als Ausbilder*innen, ggf. als Vorgesetzte haben Ärzt*innen eine Vorbildfunktion. Durch den Gebrauch unserer Sprache prägen wir das Bild von Patient*innen für uns selbst und für unsere Kolleg*innen.
Von Rettungs-Rambos und Adrenalin-Junkies
Es gibt Bereiche in der Medizin, in der verhältnismäßig mehr medizinische “Proll-Sprache” gesprochen wird als in anderen, namentlich die Intensiv- und Notfallmedizin.
Ich kenne das Biotop ganz gut, weil ich mehrere Jahre im Rettungsdienst gefahren bin und auf verschiedenen Intensivstationen gearbeitet habe. Dort legt man gern den Penis auf den Tisch, übertragen gesprochen.

Eine kleine Kostprobe: “Bettplatz 5 ist mit dem Druck in die Knie gegangen, deshalb haben wir ihm großzügig Volumen angeboten. Aber später hat der Kreislauf die Grätsche gemacht und er ist katecholaminpflichtig geworden.”
In leichte Sprache übersetzt heißt das so viel wie: “Der kranke Mensch, der im Bett mit der Nummer 5 liegt, ist fast ohnmächtig geworden. Deshalb haben wir ihm Flüssigkeit in die Vene gegeben. Leider hat das nicht geklappt und es mussten noch starke Medikamente dazu gegeben werden.”
Man muss weder Linguist*in, noch Medizinethiker*in sein, um den Unterschied dieser beiden Mitteilungen zu erfassen. Während Nummer eins einen abgebrüht-kompetenten Eindruck bei zugleich völliger Entfremdung vom Objekt der Arbeit (nämlich dem lebendigen Menschen) transportiert, beinhaltet Nummer zwei die Wahrheit eines menschlichen Gegenübers ebenso wie die Vorstellung, dass der Therapieversuch der alleinigen “Volumengabe” (ein total beknacktes Wort) gescheitert ist und damit das Scheitern der Behandler*innen mitimpliziert.
Da der Adressat der Mitteilung ein*e andere*r Medical Professional ist, können wir nur mutmaßen, dass es sich entweder um ein intrapsychisches Bedürfnis des/der Sendenden nach Anerkennung handelt oder um ein Milieu, in dem zur Schau getragene Lässigkeit mit Kompetenz gleichgesetzt wird. Oder beides.
Ich persönlich hatte das große Glück, dass mir auf “meiner” Intensivstation ein besonderer Mensch in einer Schlüsselposition begegnet ist: Thomas war Intensivkrankenpfleger und leitete das Pflegepersonal der Station.
Sprache bestimmt Bewusstsein
Obwohl er es hinter einer brummig-bärbeißigen Art gut verstecken konnte, lag seinem Führungsstil ein zutiefst humanistisches Menschenbild zugrunde. Er achtete penibel darauf, dass wir unsere (wehr- und sprachlosen, weil überwiegend beatmeten) Patient*innen auch mit unserer Alltagssprache wertschätzen.
Das Resultat war erstaunlich: ein menschliches Team, fehlende Sprachverrohung, eine sehr gute Arbeitsatmosphäre und ein relativ niedriger Krankenstand.
Thomas hat seine Vorbildfunktion im Wortsinn vorbildlich erfüllt. Er war auch derjenige, der mir den theoretischen Überbau seines Handelns philosophisch erläuterte durch den Satz “Sprache bestimmt Bewusstsein”.
Diese These der amerikanischen Linguisten Edward Sapir und Benjamin Lee Whorf aus den 1930er Jahren besagt, dass nicht nur die Wahl der Worte, sondern sogar die grammatikalische Struktur der Sprache, die ich spreche, mein Denken beeinflusst. Die Idee ist zwar gut 100 Jahre alt, wird aber durch moderne neurowissenschaftliche und anthropologische Forschung nachträglich gestützt.
Ein paar Beispiele: Es macht einen Unterschied, ob ich von einem “Schwangerschaftssbbruch” oder von einem “Embryonen-Mord” rede. Es versteht sich von selbst, dass ich Menschen, die gebürtig aus Afrika stammen, nicht als “Kaffer” bezeichne und Männer, die Männer lieben, nicht als “Schwuchtel”. Die Konnotation wird völlig anders, wenn ich eine Darmspiegelung als “große Hafenrundfahrt” bezeichne, oder ein psychiatrisches Krankenhaus als “Lala-Ranch”.
Zusammenfassend ist es also sehr wichtig, die Wahl meiner Worte in Bezug auf meine Patient*innen immer gut zu überdenken.
Dysfunktionaler Selbstschutz
Leider habe ich eine solche Haltung wie die von Thomas nicht oft in medizinischen Zusammenhängen erlebt. Zynismus und der Gebrauch von Sprache mit Machismo-Tonfall ist in der Notfallmedizin die Regel, nicht die Ausnahme. Und auch delirante, verwirrte, verängstigte Intensivpatient*innen sind gerne mal – na, was wohl – “überlagert”.
Das liegt auch daran, dass der Aspekt der Entfremdung (und damit Entmenschlichung) für die Behandler*innen eine wichtige psychische Funktion übernimmt: er bietet eine krude Form der Abgrenzung.
Wenn mir die Schicksale der mir anvertrauten Menschen so sehr zu Herzen gehen, dass ich permanent schluchzen muss, kann ich schwerlich die erforderliche Fokussierung aufbringen, um sie adäquat zu behandeln. Ich muss mich als Ärztin vom Erleben der Patient*innen abgrenzen, wenn ich meinen Beruf ordentlich ausüben und nicht binnen kurzem ausbrennen möchte.

Lange Zeit habe ich (stets nur halb im Scherz) behauptet, dass ich vor allem deswegen Medizin studiert hätte, um am richtigen Ende der Nadel zu sitzen. Humor ist eine gute Form der Abgrenzung und Abwehr, die ich dringend brauche, wenn das Menschliche an sich (und der ethische Grenzbereich) mein Arbeitsgebiet ist.
Umso mehr gilt dies in einem Fach wie der Notfallmedizin, in dem es zu vielen Todesfällen, schrecklichen Schicksalen oder dem Überwiegen von Therapiemethoden kommt, die zwar dem physischen Überleben dienen, die aber für die Behandelten die Hölle sind (z. B. der Aufwachprozess beim Weaning).
Hinzu kommt die allgegenwärtige ärztliche Hybris, Herscher*in über Leben und Tod zu sein. Darin liegt die narzisstische Falle, jede*n Tote*n mit persönlichem Versagen gleichzusetzen. Das ist schwer auszuhalten.
Abgrenzung ist notwendig
Um also meine Arbeit vernünftig machen zu können, brauche ich gute Abwehrmechanismen und bewusste Formen der Abgrenzung. Das wird jede Psychotherapeutin so unterschreiben.
Aber während Psychotherapeut*innen eine lange und intensive Ausbildung genießen, in der gesunde Arten der Abgrenzung – gute Ich-Funktionen, reife Abwehrmechanismen, aber auch Sport, soziale Kontakte, Hobbies, u.v.m. – erlernt, bzw. gestärkt werden, haben somatisch tätige Ärzt*innen meist nur die Vorbilder in ihrer Peergroup. Und wenn ein ausgemachter Zyniker und Misanthrop wie Dr. House in eine Führungsposition kommt, kann er sein Team schnell auf den Pfad des entmenschlichten Denkens führen.
Der Witz ist: die sich im Sprachgebrauch zeigende Abgebrühtheit ist zwar kurzfristig entlastend, führt aber langfristig durch eine ausbleibende emotionale Auseinandersetzung (und durch Sinnentleerung) zu Unzufriedenheit, innerer Leere, Burn-Out-Gefahr.
Das 50% aller Notärzt*innen im Laufe ihres Berufslebens einen Burn-Out erleiden, hängt sicher auch mit dieser nicht funktionierenden Abgrenzung zusammen.

Die psychotherapeutische Dimension
In der Psychotherapie nennen wir so etwas einen dysfunktionalen Lösungsversuch. Weitere Beispiele für dysfunktionalen Umgang mit psychischer Belastung auf der Arbeit wären: exzessiver Alkoholkonsum (gesellschaftlich als “Work hard, play hard” idealisiert), wahllose Affären, Tablettenmissbrauch oder sozialer Rückzug. Oder eben zynische, entmenschlichte Sprache zu benutzen.
Psychodynamisch würde man auch von einem Abwehrmechanismus sprechen, obwohl es streng genommen eine Kombination aus mehreren Mechanismen ist:
Zynischer Sprachgebrauch wie das Sprüchlein von der Überlagerung verlangt zunächst eine Verleugnung. Anders als bei der Verdrängung wird hier die Realität kognitiv wahrgenommen – zum Beispiel “Die Patientin klagt unentwegt über Übelkeit” – aber der dazugehörige Affekt wird verleugnet – zum Beispiel “Ich fühle mich hilflos angesichts eines Symptoms, das ich nicht kontrollieren kann”.
Der verleugnete Affekt – die Hilflosigkeit – ist aber trotzdem da und wird ggf. als anderer Affekt empfunden. So wird aus Hilflosigkeit zum Beispiel eine deutlich besser auszuhaltende Genervtheit.
In einem zweiten Schritt erfolgt dann die Distanzierung vom Gegenüber durch den Mechanismus der Entwertung, die sich gerne in Sarkasmus zeigt.
Um keine Missverständnis aufkommen zu lassen, Abwehr ist nichts per se schlimmes, nicht mal der Gebrauch von narzisstischen Abwehrmechanismen wie der Entwertung. Zum Problem wird es erst, wenn ein bestimmter Mechanismus ausschließlich oder überwiegend eingesetzt wird.
So ist es auch mit zynischer Sprache: für die eigene Psychohygiene kann es manchmal entlastend sein, sie zu benutzen. Wenn sie aber die hauptsächliche Art von Medical Professionals ist, über Patient*innen zu sprechen, ist es nicht mehr gesund (oder zumindest für die betroffenen Patient*innen ein Drama).
Und jetzt?
Am besten wäre es, wenn auch somatisch tätige Ärzt*innen eine regelmäßige Supervision und Unterstützung ihrer fordernden Tätigkeit bekämen.
Da dies (begleitet vom hohlen Gelächter von Gesundheitsminister*innen und Vertreter*innen der Krankenkassen) eine eher unrealistische Vorstellung ist, ist jede*r selbst verantwortlich, Zynismus und Sprachverrohung bei sich zu vermeiden.
Sich der Problematik bewusst zu sein, ist auf jeden Fall ein erster Schritt.
Bild oben: von Susanne Jutzeler (suju-foto) auf Pixabay
Weiterführende Literatur
- Joseph Egger über das Biopsychosoziale Modell im der Schweizerischen Ärztezeitung
- Das statistische Bundesamt zu Todesursachen in Deutschland
- Ursachen für Berufsunfähigkeit beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
- Psychische Gesundheit von Notärzt*innen beim Informationsdienst der Gemeinschaft für Forschung und Entwicklung (CORDIS) der Europäischen Kommission
- Spiegel-Kommentar zur Verwendung des Begriffs Morbus mediterraneus
- “Wie Sprache das Denken formt” auf Spektrum.de
- Zum Zusammenhang von Satzbau und Denken auf Forschung-und-Lehre.de, dem Wissenschaftsmagazin des Deutschen Hochschul Verbands (DHV)
- Homepage der Deutschen Balint-Gesellschaft – der Besuch einer Balintgruppe ist eine ziemlich gute Idee, um bewusst die ärztliche Beziehungsfähigkeit zu verbessern (und damit das individuelle Burn-Out-Risiko zu senken)