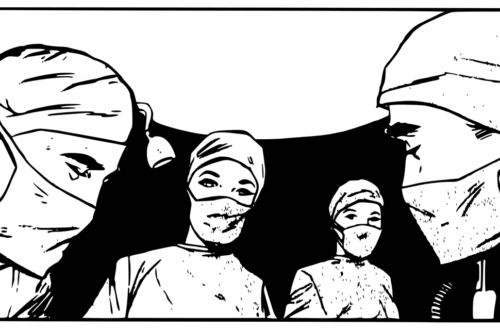Wer braucht hier Beruhigung? Von Konsilanforderungen in der Psychosomatik
Ein rotes Kreuz blinkt hektisch neben dem Namen der Patientin. “Notfall” informiert mich das Informationssystem.
Wieso eigentlich Notfall?
“Patientin weint!!!” hat der unfallchirurgische Kollege in der Anamnese ergänzt. Mit drei Ausrufezeichen!!! Weint!!! Die Patientin!!! Mein Gott!!! Und was soll er da jetzt tun, der Jungassistent in der Unfallchirurgie? Na klar: die Psychotante anfordern.
Wenn ich meine fünfjährige Tochter fragte, was man mit einem Menschen macht, der weint, würde sie vermutlich so etwas sagen wie: “In den Arm nehmen.” oder “Trösten.”
Und Kindermund tut auch an dieser Stelle Wahrheit kund: ein weinender Mensch sollte getröstet werden. Sofort. Von dem Menschen, der ihm oder ihr gegenüber sitzt. Dafür braucht man nämlich nicht mal ein Studium, geschweige denn eine Psychotherapieausbildung.

Trotzdem zockel ich treudoof auf die unfallchirurgische Station. Und anstatt – wie es beispielsweise in der Radiologie eine lieb gewonnene Gepflogenheit ist – den anfordernden Jungassistenten für die nicht vorhandene Fachsprache, die fehlerhafte Indikationsstellung und die allenfalls implizit wahrnehmbare Fragestellung in der Konsilanforderung in der Luft zu zerreißen, schau ich mir die Sache mal an.
Zumal ich es selber wenig schätze, aus geringem Anlass angekeift zu werden.
Kommunikative Ausbildung: nur so mittel
Fairerweise muss auch gesagt werden, dass das Medizinstudium (bisher) nur so mittel auf die zwischenmenschlichen Herausforderungen des ärztlichen Berufs vorbereitet. Und dass trotz der Millionen Fakten, die man sich in den Kopf schaufelt, die korrekte Formulierung von Konsiliaranforderungen nicht auf dem Lehrplan steht.
Deshalb für alle Unwissenden da draußen: da die Konsiliaria ein Konsilium (=einen Ratschlag) zu erforderlichen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen erstellen soll, braucht sie Zugang zu den Diagnosen, Vorerkrankungen, Medikamenten usw. der entsprechenden Patient*innen inclusive einer Beschreibung der akuten psychischen Symptome.
Und sie braucht eine möglichst konkrete Fragestellung. Bedauerlicherweise handelt es sich bei dem Satz “Bitte um konsiliarische Mitbetreuung” nicht um eine solche, sondern um eine sinnentleerte Floskel. Als Faustregel und inneren Bullshit-Detektor darf gerne die Frage “Würde ich das auch in eine internistische Konsilanforderung schreiben?” gestellt werden.
In meinem heutigen Fall handelte es sich um eine 69jährige Dame, die durch besagten Kollegen erfahren hat, dass der Bruch ihres Oberschenkels auf eine Knochenmetastase zurück zu führen ist. Also dass sie – was sie vorher nicht wusste – eine Krebserkrankung hat, die auch noch metastasiert (=nicht mehr heilbar) ist. Daraufhin hat sie angefangen zu weinen.
Eine angemessene Reaktion auf eine katastrophale Nachricht
In meiner kleinen Welt ist das eine ziemlich angemessene Reaktion auf eine echt katastrophale Nachricht. Deshalb ist das aus dem Kontext gerissene Weinen auch kein psychisches Symptom.
Als ich am Bett der Patientin erschien, war das Weinen auch schon wieder vorbei. Außerdem wollte die Dame auch zunächst gar keine psychoonkologische Begleitung, weil sie – wie etwa 95% aller Menschen in dieser Situation – das Gefühl hatte, noch gar nicht realisiert zu haben, was das bedeutet. Die Psyche braucht einfach manchmal etwas Zeit.
Gab es einen zusätzlichen Auftrag?
Seit ich mal eine mehrtägige Fortbildung zum Thema psychosomatischer Konsiliardienst besucht habe, weiß ich aber, dass Konsilanforderungen immer mindestens zwei Ebenen haben: einerseits die faktische, sichtbare Ebene (die im Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun die Schön Formation darstellt) und andererseits die Ebene von ärztlicher Beziehung, Rollenkonflikten oder genuiner emotionaler Überforderung der Behandler*innen (=alle anderen Seiten des Kommunikationsquadrats).

Diese Erkenntnis hilft mir ungemein. Denn der unfallchirurgische Kollege bittet ja nicht darum um Hilfe, weil er ein Knallidiot ist, sondern weil er sich in dieser Situation nicht zu helfen weiß.
Vielleicht erinnert ihn die Patientin an seine Mutter. Vielleicht hat er selbst totale Angst vor Krebserkrankungen. Vielleicht hindert ihn eine innere Vorstellung von Männlichkeit oder ärztlicher Rolle, seiner menschlichen Intuition zu vertrauen (und die Frau einfach zu trösten). Vielleicht sitzt ihm der Oberarzt im Nacken und setzt ihn unter Druck. Vielleicht ist es auch noch ein völlig anderer Grund.
Deshalb kann ich mich dafür entscheiden (um bei Schulz von Thun zu bleiben), mit dem Appelohr die Not des Kollegen zu hören. Wenn ich diesen Menschen jetzt von oben herab abkanzle (für die misslungene Anforderung), produziere ich damit bestenfalls Ressentiments und Widerstand.
Ich kann dem Kollegen (und damit indirekt der Patientin) viel besser helfen, indem ich meine Vermutungen anspreche (“Es ist bestimmt nicht leicht, solche Diagnosen zu überbringen. “) und damit einen Raum öffne, in dem das Gefühl gespürt und geäußert werden darf. Ich validiere damit das Empfinden, wo vorher vielleicht ein “Aber ein Arzt darf doch sowas nicht denken” war.
Den Perspektivwechsel anregen
Wenn ich dann noch die Reaktion der Patientin verstehbar mache (“Diese Krebsdiagnose ist erstmal ein Hammer für Frau X. Sie steht ja mitten im Leben.”) und normalisiere (“Ich fände es unnormal, wenn sie wegen ihrer Diagnose freudig erregt wäre.”) habe ich hoffentlich noch ein basales Empathietraining angeschlossen und dem Kollegen für die nächste Situation die Berührungsängste genommen.
Es gehört zum geheimen Erfahrungswissen psychosomatischer Konsiliarärzt*innen, dass die Entlastung und Beruhigung der Behandler*innen (manchmal sogar eines ganzen Teams) fast ebenso häufig vonnöten ist, wie die Entlastung und Beruhigung der Patient*innen. Es ist die psychotherapeutische Kunst, auf die Schnelle zu erfassen, was der implizite Auftrag an mich ist.
Die Gegenübertragung in dieser Beziehung zwischen zwei Behandler*innen wird oft schon beim Lesen der Anforderung spürbar. Und wenn ich bereits dann selber das Gefühl habe, auf 180 zu sein und dringend einen Schnaps zu brauchen, darf ich mich dann auch kurz der eigenen Beruhigung widmen, bevor ich dann alle anderen Beteiligten beruhige.
Ein Freund, der in einem IT-Support-Team vermutlich vergleichbar bescheuerte Anfragen bekommt, hat mir mal verraten, warum er sich über die vermeintlich sinnlosen Anforderungen nicht ärgert: “Die sichern meinen Job. Und wenn der dann noch Easy Going ist, finde ich das umso besser.”
Denn es ist eine Binsenweisheit sowohl in der Psychotherapie als auch in der IT oder in der Notaufnahme: es kann nur diejenige einen kühlen Kopf bewahren (um aus dieser Ruhe das Richtige zu tun), die auch tatsächlich ruhig ist. Und manchmal genügt für Behandler*innen der äußere Anschein von Gelassenheit, um die inneren Ängste zu überwinden.
Oder wie es im Klassiker “House of God” heißt: “Im Notfall immer erst eigenen Puls tasten.” Klingt nach einem prima Tipp!
Oberes Bild: von whoalice-moore auf Pixabay