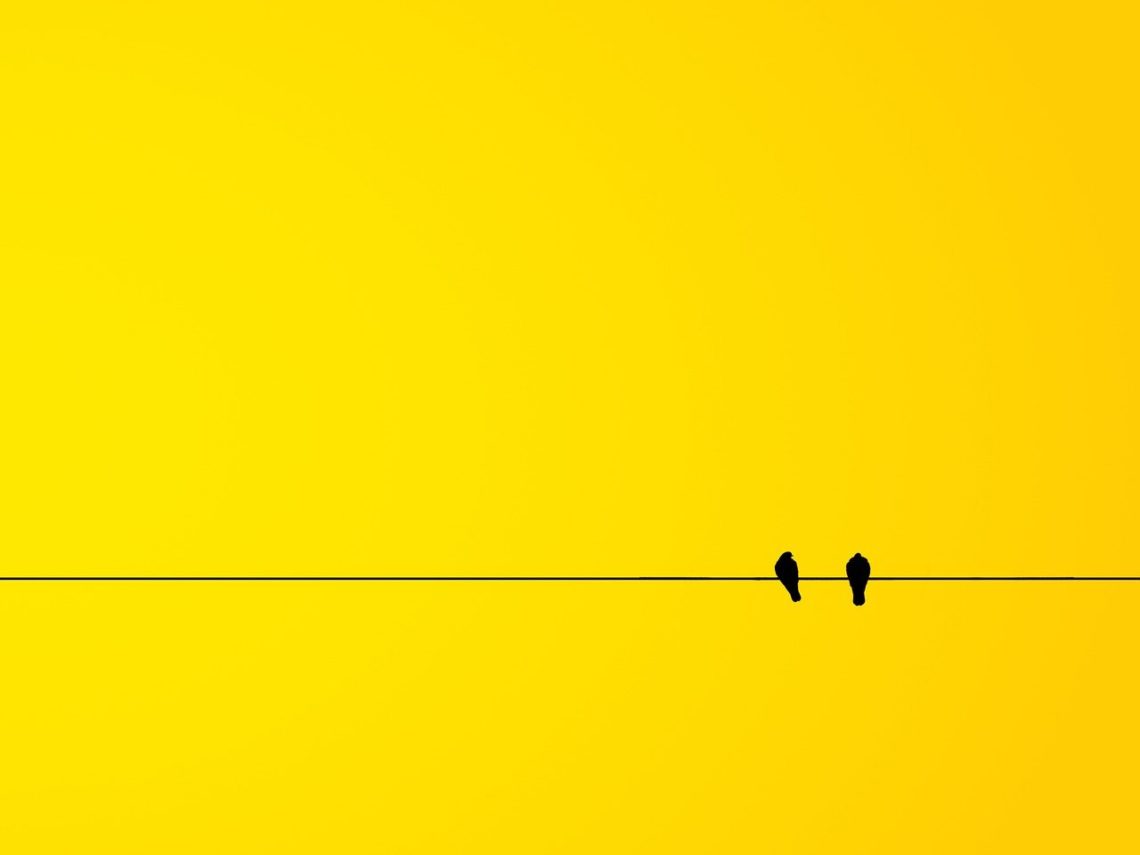
Vom Schmerz, die zweite Bindungsperson zu sein
Abendritual mit Hindernissen
Vertrauensvoll kuschelt sich mein zweijähriger Sohn in meinen Arm und lässt sich von mir die Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Eben noch haben wir getobt, jetzt sieht das Abendritual vor, dass ein bis acht Bücher gelesen werden, erst danach darf ich das Licht ausmachen. Normalerweise schläft er dann friedlich an mich geschmiegt ein.
Normalerweise. Heute ist er aber erkältet. Er hustet und schnieft und fühlt sich wahrscheinlich so malad, wie wir Großen uns auch fühlen, wenn ein Erkältungsvirus uns erwischt. Deshalb ruft er heute Abend untröstlich nach seinem Papa, obwohl ich bei ihm bin. Er weint zornig und stößt mich von sich.
Als ich es gerade schaffe, ihn wieder halbwegs zu beruhigen, passiert das Unvermeidliche: Papa, der das Weinen des Kindes seit fünf Minuten hört, steckt den Kopf zur Tür rein. „Kann ich helfen?“
Damit habe ich natürlich keine Chance mehr, mein Kind zu erreichen. Unter lautem Geheul (also des Kindes, nicht mein eigenes) übergebe ich das Kind in Papas Arme und verlasse frustriert das Kinderzimmer.
Von den Tücken der nicht-traditionalistischen Beziehungsgestaltung
Normalerweise bin ich sehr stolz auf die moderne Beziehung, die mein Mann und ich führen: wir haben beide die wöchentliche Arbeitszeit auf die gleiche Stundenzahl reduziert, wir erledigen gemeinsam alle Haushalts- und Kinderbetreuungstätigkeiten, wir haben die Elternzeit paritätisch geteilt und teilen uns gerecht die Nächte auf, in denen wir das jüngste Kind versorgen, dessen Schlafrhythmus noch nicht so reif ist, wie wir es gerne hätten.
Wir gewinnen dadurch ein anstrengendes, aber für alle Seiten weitgehend erfüllendes Familien- und Berufsleben, das nicht eine*n Partner*in übermäßig beansprucht.

Bild von Oberholster Venita auf Pixabay
Mit regelmäßigem Ausprobieren verschiedener Modelle tasten wir uns an die Variante heran, mit der wir als Paar, als Eltern und als Familie glücklich sind und reagieren flexibel auf Veränderungen in der Familienkonstellation. So viel zu den Pros.
Aber dadurch, dass wir die traditionalistische Rollenverteilung nicht leben, kommt es eben an manchen Stellen zu einem Bruch der Erwartungshaltung. Und die „klassische Erwartungshaltung“ lautet: Die Mutter ist automatisch (qua Naturgesetz) Nummer eins für das Kind.
Ich stelle zu meinem Erstaunen fest, dass ich mich von der eigenen Sozialisation auch nicht völlig freimachen kann. Es schmerzt einfach ziemlich, eben nicht die Nummer eins zu sein. Ich bin eifersüchtig auf meinen Mann. Plus: die gute alte „Ich bin eine schlechte Mutter“ Falle wird aktiviert. Insuffizienzgefühle, Versagensängste, schlechtes Gewissen, das volle Programm. Rabenmutter-Kopfkino.
Ein Vatergefühl?
Die meisten Mütter kennen die oben geschilderte Situation (in Variationen) vermutlich aus der Perspektive derjenigen, die bevorzugt vom Kind gewünscht wird, während der Vater sich bemüht, das Kind ins Bett zu bringen o.ä.
Ich habe also erleben dürfen, was viele Väter als enttäuschende (und offenbar schmerzhafte) Erfahrung kennen: vom eigenen Kind, das man so liebt und um das man sich so bemüht zurückgewiesen werden, weil der andere Elternteil vermeintlich mehr geliebt wird.
Aber ist das wirklich so?
Um zu begreifen, was da in meinem Kind vorgeht (und dass es eben nicht um mehr oder weniger Liebe geht), möchte ich gerne den Bogen schlagen zur Überschrift des Artikels: ich bin die sekundäre (nicht die primäre) Bindungsperson.
Bindung (englisch: Attachment) beschreibt das unsichtbare Band zwischen dem Kind und seinen Bindungspersonen (und später im Leben die unsichtbaren Bänder zwischen Freund*innen, Partner*innen, Liebenden).
Ich schreibe hier ganz bewusst das unpersönliche Wort „Bindungspersonen“, denn die Bindung ist kein Naturgesetz, das sich durch genetische oder leibliche Elternschaft erfüllt. Während die frühen Bindungsforscher*innen (aus der gesellschaftlich vorherrschenden Realität heraus) noch exklusiv von der Bindung zwischen Mutter und Kind sprachen, weiß man heute, dass selbstverständlich auch Väter, Großeltern, Geschwister, Erzieher*innen o.ä. Bindungspersonen werden können.
Bindung entsteht nicht nur durch die quantitative Zeit, die wir mit unserem Nachwuchs verbringen. Wichtig ist auch die Qualität unseres gemeinsamen “Attunements”, der Feinabstimmung zwischen dem großen und dem kleinen Menschen. Eltern müssen so schnell es ihnen eben möglich ist begreifen, was der winzige, noch sprachlose Säugling ihnen mitteilen möchte, wenn er schreit und weint.

Bild von Caitlin Johnstone auf Pixabay
Anfangs ist die Summe der möglichen Bedürfnisse nicht größer als etwa
- Aua
- Pipi / Kacka
- Hunger / Durst
- kalt / warm
- Liebe
- und: ich weiß es nicht so genau
Je schneller und je adäquater das Bedürfnis von den Bindungspersonen erkannt wird und je besser dem Bedürfnis nachgegangen wird, desto besser ist die Bindung. Bindungsforscher*innen nennen diese elterliche Fähigkeit “Feinfühligkeit”.
Dieses Eingrooven zwischen Eltern und Kind funktioniert häufig mit der Bindungsperson am besten, die am meisten Zeit mit dem Kind verbringt. Da das in unserer Gesellschaft meistens die Mutter ist, dachte man lange, dass das Kind nur an eine Person binden kann. Heute wissen wir, dass auch sehr kleine Kinder viele “Bindungsstellen” besitzen, denn neben ihren Eltern können sie Bindung zu Großeltern, Kita-Erzieher*innen und ihren Geschwistern aufbauen. Es gibt aber immer eine Haupt-Bindungsperson.
So bildet sich im Laufe der Zeit eine Art Bindungshierarchie: primäre, sekundäre, tertiäre Bindungsperson. In emotionalen Stressmomenten wendet sich das Kind automatsch an die Person, die in der Hierarchie am höchsten steht: Wenn mein Mann da ist, ist er es. Wenn er nicht da ist, bin ich es. Wenn auch ich gerade nicht im Raum bin, ist es die große Schwester…
Diese Hierarchie ist hochdynamisch und fluide. Denn jede neue Beziehungserfahrung jeden Tag füttert die Bindung zwischen Eltern und Kind. Und natürlich findet im Laufe der psychischen Entwicklung eine Internalisierung von “Papa”, “Mama” und allen anderen Bindungspersonen statt, so dass die Bindungshierarchie mit der Zeit nicht mehr sichtbar ist.
Ausblick
Also gibt es auch für mich Grund zur Hoffnung. Als ich mich neulich morgens für den Weg zur Arbeit rüstete – was, da ich auch im Winter konsequent mit dem Fahrrad fahre, derzeit eher einer Vorbereitung auf eine Mount-Everest-Besteigung gleicht – kam mein Sohn heran, um mich neugierig zu beobachten.
Mit glänzenden Augen betrachtete er meine anthrazitfarbene Ski-Latzhose und stellte mit Kennermiene fest: “Feuerwehrhose”. Wobei er anerkennend nickte. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit kann ich da nicht leugnen.
Und als ich dann noch die – zugegeben nur mittelcoole – gelbe Warnweste anzog, die ich aus mütterlichen Sicherheitsgründen trage, platzte es voller Ehrfurcht und Erstaunen aus ihm heraus: “Mama Bauarbeiter ist?”
Ich bin also in der Herzens-Hierarchie meines Kindes durch die bloße Macht meiner trendbewussten Kleidung ein paar Stufen nach oben gerutscht. Und morgen kaufe ich mir einen Bauarbeiter-Helm… 🙂

Bild von Alejandra Jimenez auf Pixabay
Bild ganz oben von Michal Jarmoluk auf Pixabay




